Phädra
Liste der Aufführungen
[danach: Milton]
In französischen Zeitungen
ward neulich empfindlich bespöttelt, daß ein deutscher Kritiker von dieser
Uebersetzung geurtheilt habe: durch sie sey nicht bloß das Original erreicht,
sondern noch übertroffen worden. Wenn deutsche Kritiker nun über etwas die Nase
verächtlich rümpfen, worüber das einstimmige Lob ganzer Nationen ertönt, und
daheim eine Autorität als rein unfehlbar preisen, so ist das freilich eine
Alltagserscheinung. Eben so aber wenn die Franzosen auf uns von der Höhe
herabsehen; ein Dünkel, der neuerdings sich wieder beträchtlich mehrte. Warum
das Seinige nicht jedermann?
Wie kam jedoch Schiller bei
seiner hohen Originalität zu Uebersetzungen überhaupt? Wie zu einer aus dem
Französischen, er, dessen früherer Geschmack so entschieden für die Formen
Shakespears, dessen späterer für jene des Aeschylus und Sophokles sprach; von
dem Göthe des Mahomeds halber dichterische Vorwürfe hören mußte? Die Frage
beantwortet sich, wenn man aufrichtig seyn will, am leichtesten, indem man den
Grund davon in einem Gefühl abnehmender Kraft des Dichters, durch körperliche
Zerrüttung herbeigeführt, erblickt. Diese Uebersetzung war eine Arbeit, um zu
arbeiten.
Racine und Schiller, – jener
ein unterwürfiger Diener geforderter Beschränkungen der Kunst; der sich sogar
mit ihren Gehegen willkührlich noch enger umwand; der ewig furchtsam, die
klassische Decenz zu verletzen, nur durch die zarte Wahl des Ausdrucks zu
wirken strebte; – dieser der im Innern des Genius nur seine Gesetze fand, der in
den späterhin übernommenen Fesseln, trotz des noch reichlichen übrigen
Spielraums immer etwas fremd erschien, der über der kühnen Zeichnung der
Leidenschaft häufiger das wahrste, als das lieblichste Wort ergriff; wieder
aber, wenn er sich über die anschauliche Natur emporschwang, den Idealen der
Poesie höher nachflog, als je die Ahnung des Franzosen reichte? – Racine und
Schiller? – Fern sey es von mir irgend eine der Schönheiten dieser Uebersetzung
zu verkennen, aber dreist sag’ ichs demungeachtet: unter allen größeren
Arbeiten Schillers gefällt sie mir am allerwenigsten. Und sicher pflichten mir
viele bei. Es hätte der correkte Wohllaut der Diktion müssen übertragen werden,
um Racinens Hauptvorzug wieder zu finden, correkter Wohllaut wurde aber von
Schillern nie, (mit Ausnahme einiger lyrischen Episoden) geübt. Wir empfangen
hier reimlose Jamben, zwar an sich recht brav gefertigt, auch reichlich durchglüht
von Schillers Geist; aber was sind sie gegen die Racinesche Melodie? und beides
macht, daß wir Reminiscenzen an den Platz des französischen Geists (und auf den
Nachklang des letztern kam es doch an) empfinden. Auch die Uebersetzung in
mechanischer Ansicht, trift nur zu oft der Vorwurf der Weitschweifigkeit. Z.
B.:
Oenone.
Juste ciel! tout mon sang dans mes veines se glace
O désespoir! o crime! o déplorable race!
Voyage infortuné! rivage malheureux,
Falloit-il approcher de tes bords dangereux!
Gott! All mein Blut erstarrt
in meinen Adern
O Jammer! o Verbrechenvolles Haus
Des Minos! Unglückseliges Geschlecht!
O dreimal unglückselge Fahrt! Daß wir
An diesem Unglücksufer mußten landen.
Schiller wollte hier durch
dreimalige Wiederholung des Wortes Unglück den Nachdruck verstärken; es gelang
aber nicht, er geht theils durch das sogenannte Enjambiren, theils durch die
prosaische letzte Zeile verloren. Ferner:
Phedre.
Je te l’ai prédit ; mais tu n’as pas voulu;
Sur mes justes remords tes pleurs ont prévalu;
Je mourois ce matin digne d’ètre pleurée;
J’ai suivi tes conseils ; je meurs déshonorée.
Ich sagte dirs vorher.
Du aber hörtest nicht, mit deinen Thränen
Besiegtest Du mein richtiges Gefühl.
Noch heute früh starb ich der Thränen werth,
Ich folgte deinem Rath und ehrlos sterb ich.
Der Numerus ist hier doch
ganz verwischt. So auch hier mit der Kürze
zugleich:
Thésée.
O mon fils! cher espoir que je me suis ravie:
Inexorables dieux, qui m’avez trop servi!
A quels mortels regrets ma vie est reservée.
O süße Hoffnung, die ich
selbst mir raubte,
Mein Sohn! Mein Sohn! Ihr unerweichten Götter,
Mir habt ihr nur zu gut gedient! – Mein Leben
Hab ich dem ew’gen Jammer aufgespart!
Dagegen ist Theramenens Erzählung
vom Tode Hyppolits, (wo, beiläufig gesagt, Racine des Vaters Jammer doch zu
sehr, durch Bezeichnung jedes schrecklichen Nebenumstands anhäufen läßt) im
Allgemeinen trefflich gerathen, und ergreift tief. Das berühmte: L’essieu crie
et se rompt heißt: Die Achse kracht, sie bricht, – und ist gewiß eben so
malerisch.
Les ronces dégouttantes
Portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. heißt offenbar viel schöner
bei Schiller:
– es tragen
Die Dornen seiner Haare blutgen Raub.
So sagt auch Theramen im
ersten Akt bei Schiller: Ach Herr, wenn deine Stunde kam, so fragt Kein Gott
nach unsern Gründen
Poetisch ist das zwar nicht,
möchte aber doch den Vorzug gegen dieselbe Rede
bei Racine verdienen: Ah
Seigneur! si votre heure est une fois marquée, Le ciel de nos raisons ne sait
point s’informer.
Das ne sait wird doch, da die
Rede von den Göttern ist, anstößig, und die Spitzfindigkeit, die dazu den Schlüssel
etwa im Schicksal suchen wollte, hielte wenig Stand.
Der Raum ist zu karg, um noch
mehrere Beispiele anzuziehen. – Darf man nun gegen die Uebersetzung als solche
im Allgemeinen manches rügen, so ists ein andres mit dem Spiel. So hohe
tragische Kunst erblickten wir noch selten auf unsrer Bühne. Wenn mich nicht
die trunkne Bewunderung der Phädra unsrer Bethmann noch in diesem Augenblick täuschend
hinreißt, so bin ich überzeugt, daß ihre Maria Stuart, ihre Fürstin von
Messina, und alles was wir je von ihr sahen, bei weitem hinter dieser Phädra
zurück bleibt. Ausführlicher davon ein andermal. Hyppolit ist ein vollendetes
Meisterwerk des Herrn Bethmann. Nie sahn wir Herrn Mattausch noch in dieser
hohen kräftigen Würde, in so ächt griechischer Haltung als in diesem Theseus.
Wer das Große der Kunst schauen will und schauen kann, eile zur Phädra! – Auch
die Nebenrollen verdienen Lob. Die Aricia gab Mlle. Maaß höchst rührend. Den
Theramen hatten viele von Iffland erwartet, und das hätte allerdings Vollendung
bewirkt, doch kann man auch Hrn. Labes Fleiß und Studium darin nicht
absprechen, und er wirkte, so viel sein Organ es zugab.
– p –
[danach: Das Geheimniß]
Den 19ten: Phädra. / Die Darstellungen der Phädra gewinnen mit jedemmale,
und vom Beifall des dankbar fühlenden Publikums unterstützt, strebt das
Spiel dem Werke auf der Bahn der Vollkommenheit nach. Wird noch etwas
vermißt, so ist es in den Nebenrollen: Phädra, Hippolyt, Theseus lassen
nichts zu wünschen übrig. Theramen und Aricia (im fünften Akte) schließen
sich an die Genannten an. An einer Oenone fehlt's unserer Bühne (wie an
einer Hanna in Maria Stuart). Jomene wird nicht unbedeutend und kalt
gegeben. Von dem kurzgefaßten Lobe der Künstler komme ich auf das
Kunstwerk selbst. Racines's Phädra fand beim Entstehen den größten
Widerspruch, und unterlag eine Zeitlang der Cabale. Zugleich mit Racine,
hatte Pradon eine Phädra geschrieben, welche drei Tage später als jene
aufgeführt, und vorzüglich von den Damen der Herzogin von Bouillon, Frau von
Seolgne, Deshoulieres u.s.w.) in Schutz genommen wurde. Die Parthei hatte
die ersten Logen in beiden Schauspielhäusern in Beschlag genommen, ließ sie
in dem einen leer, füllte sie in dem anderen an, und gab so den Ausschlag.
Nicht daß Pradons Phädra ganz schlecht gewesen wäre: es bedurfte der ganzen
Schönheit der Racineschen, um jener den Sieg zu entreißen. Bei Pradon war
Phädra noch nicht mit Theseus vermählt. Arieta war ihre Freundin und
Vertraute; Phädra entdeckt in ihr die Nebenbuhlerin; nun bringt sie, aus
Eifersucht, den durch ein zweideutiges Orakel getäuschten Theseus gegen
seinen eigenen Sohn auf; dieser empfiehlt Neptun seine Rache; Hippolyt
stirbt, u. Phädra tödtet sich über seinem Leichnam. Der Plan, wie man sieht,
ist nicht übel angelegt. Die Verse sind schön und stark; Phädra ist minder
strafbar (und dieses rechnete man Pradon vorzüglich hoch an): aber die
Details sind zum Theil unausstehlich. Theseus z. B. findet seinen Sohn zu
Phädra's Füßen, und hält dessen Bitte an sie, ihr Herz seinem Vater zu
schenken, für eine Liebeserklärung. Uebrigens ist es sehr der Mühe werth,
beide Trauerspiel, worin so viele ähnliche Situationen sind, wo so manche
Stellen, so manche Reden, dem Sinne nach, dieselbiges, nur in den Worten
abweichen, nebeneinander zu stellen. Hier entdeckt man Racine's ganzes
unerreichbares Verdienst der Diktion, der Harmonie, der zarten Feinheit in
Gedanken und Ausdruck. Doch ich kann mich nicht enthalten, sowohl aus dem
Euripides, als aus seinen Nachfolgern diejenige Stelle auszuheben, worin des
von Neptun gesandten Ungeheuers erwähnt wird. Sie diene zugleich dazu einen
Begriff von Pradons Manier zu geben, und von Racine den Vorwurf abzulehnen,
als hätte er seine Beschreibung mit unnöthigen Zierrathen überladen. Beide,
Racine und Pradon, haben die Episode von Aricien aus den Gemälden des
Philostratus entlehnt. - Schillers Uebersetzung mit dem Original zu
vergleichen, verschiebe ich als die letzte und schwerste Aufgabe, bis zur
nächsten Vorstellung.
Euripides. (Bothe's Uebersetzung.)
... Zum wogenden
Seeufer blickend, sahn wir einen gräßlichen
Meerberg zum Himmel sich erheben ...
Nun schrecklicher aufbrausend, und ringsum mit Schaum
Den hohen Meerschwall weißend der empörten Fluth
Trieb's an das Land zum vierbespannten Wagen an,
Und mit des Meers zehnfach geschwollnem Wogensturz
Warf's einen Stier aus, ein abscheulich Ungeheuer,
Von des Gebrüll erfüllt das ganze Land umher
Furchtbarlich wiederhallte.
Seneca (zusammengezogen).
Es thürmt zum hohen Wall das Meer sich an,
Und wälzet Ungeheuerschwanger sich
Aufs Land, schlägt brausend an den Felsenriff.
Der Wasserberg erhebet, öffnet sich,
Speit aus sein Ungethüm, und stürzt ihm nach.
Theseus. Beschreibe mir die grausende Gestalt.
Der Bote. Hoch trug's als Stier den wasserblauen Hals;
Der grünen Stirn entfloß die stolze Mähne.
Sein Auge blitzet; Flammen sprüht der Schlund;
Aus offnen Nüstern schnaubt es Wasserströme;
In Drachenwindungen verlängert sich
Des Ungeheuers dichtgeschuppter Rücken -
Pradon.
L' eau s'enfle à gros bouillons menaçant le rivage;
L'un sur l'autre entassés, les flots audacieux
Vont braver en grondant la foudre dans les cieux;
Une montagne d'eaux s'élançant vers le sable,
Roule, s'ouvre, et vomit un monstre épouvantable;
Sa forme est d'un taureau, ses yeux et ses naseaux
Répandent un déluge et de flammes et d'eaux;
De ses longs beuglemens les rochers retontissent.
Jusqu' au fond des forêts les cavernes gémissent.
Dans la vague écumante il nage en bondissant,
Et le flot irrité le suit en mugissant.
Phädra. Verschleiert steht sie da, vor ihrem Richter Die Schuldige; er will – und kann ihr nicht Das Urtheil sprechen; höret, wenn sie spricht, Theilnehmend zu, und zieht um sie den Schleier dichter. Wem dankt sie dieses Loos? Wer täuschte so den Sinn? Das Wunder wirkten drei: Der Dichter Der Deuter, und die Künstlerin.
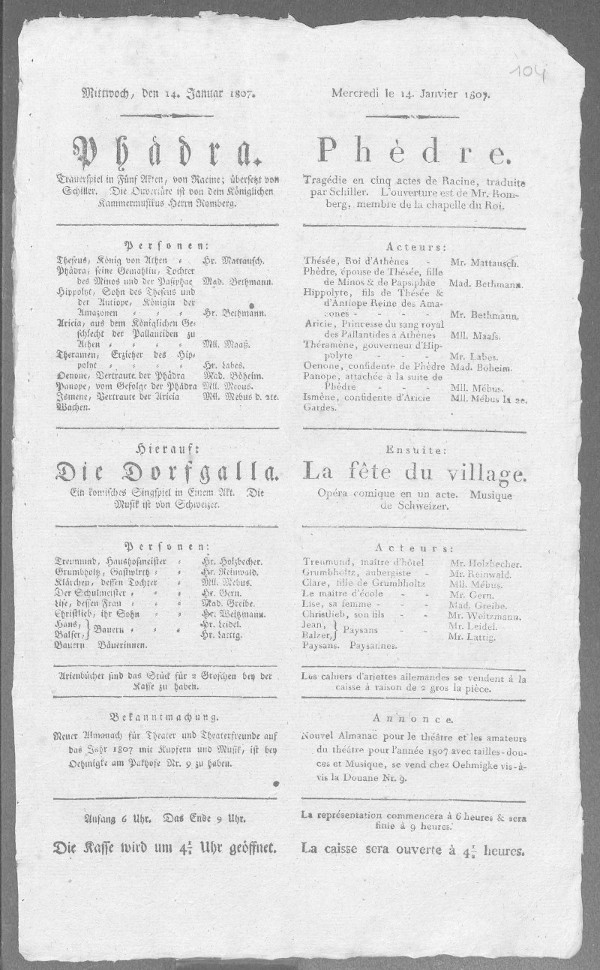
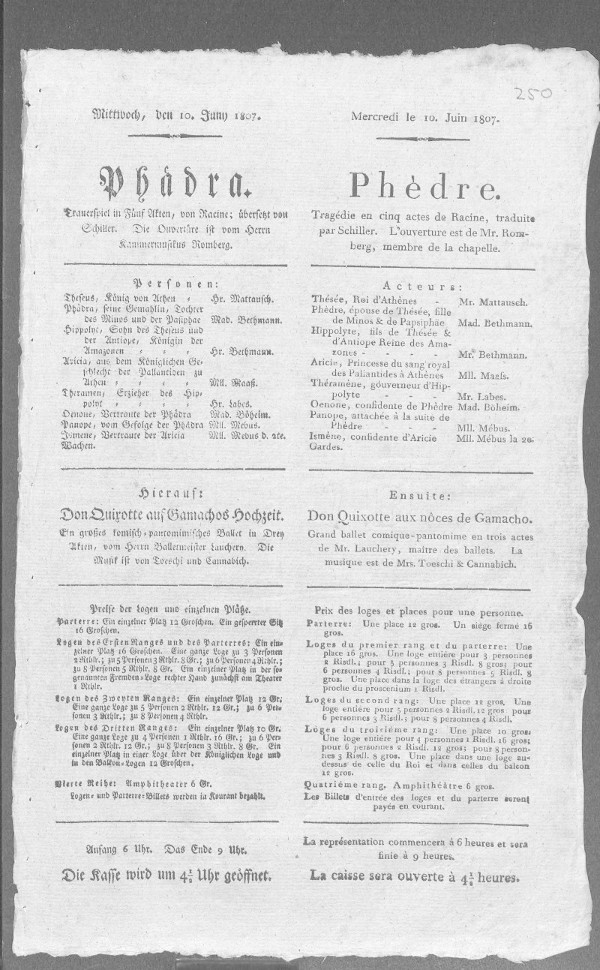
[danach: Die Heirath auf eine Stunde]
Mad. Bethmann
Hr. Bethmann
Mll. Maaß
Hr. Labes
Mad. Böheim
Mll. Ritzenfeldt
Mll. Schick
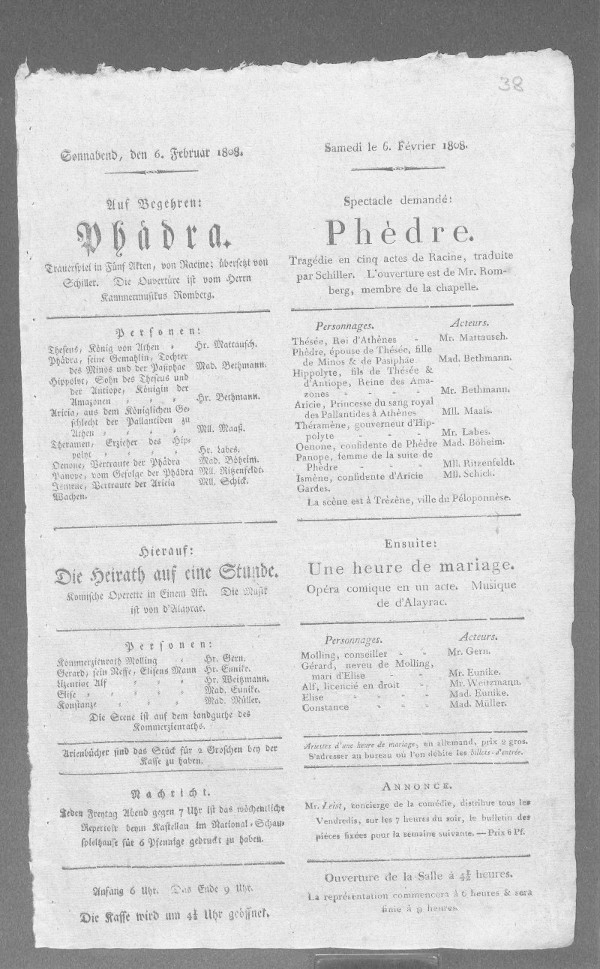
Mad. Bethmann
Hr. Bethmann
Mll. Schröck
Hr. Labes
Mad. Böheim
Mll. Ritzenfeldt
Mll. Schick
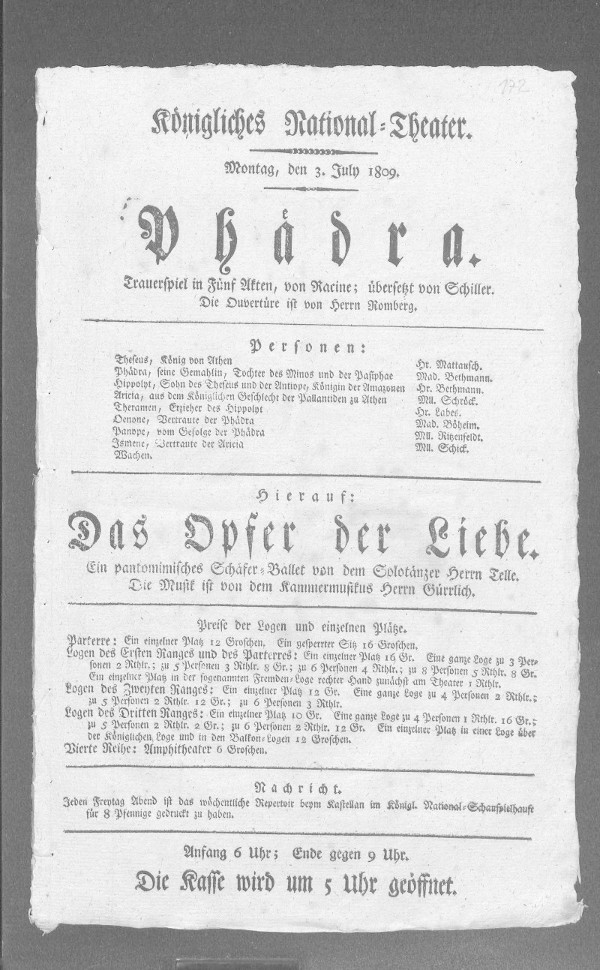
Mad. Bethmann
Hr. Bethmann
Mll. Maaß
Hr. Labes
Mad. Böheim
Mll. Ritzenfeldt
Mll. Hudemann
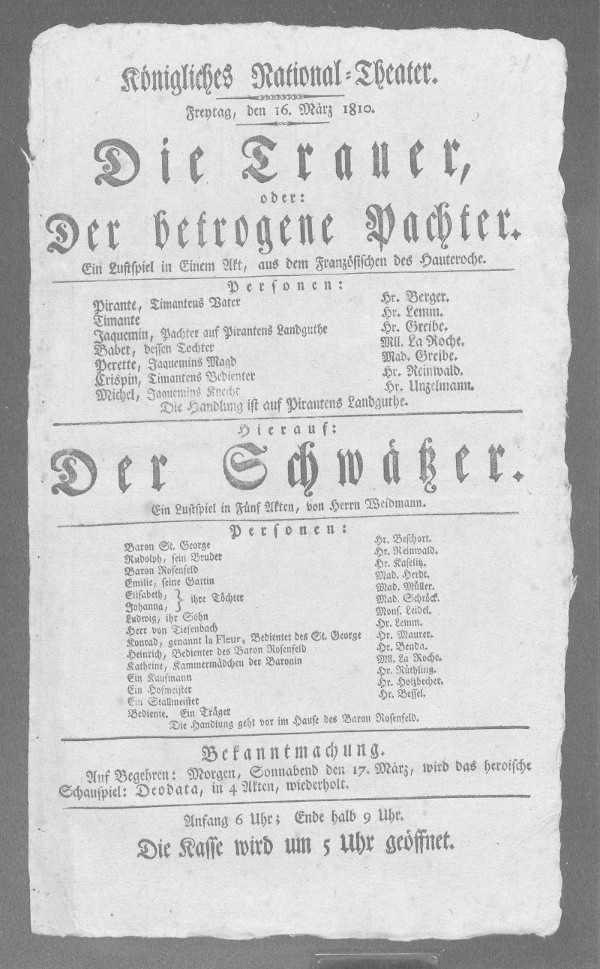
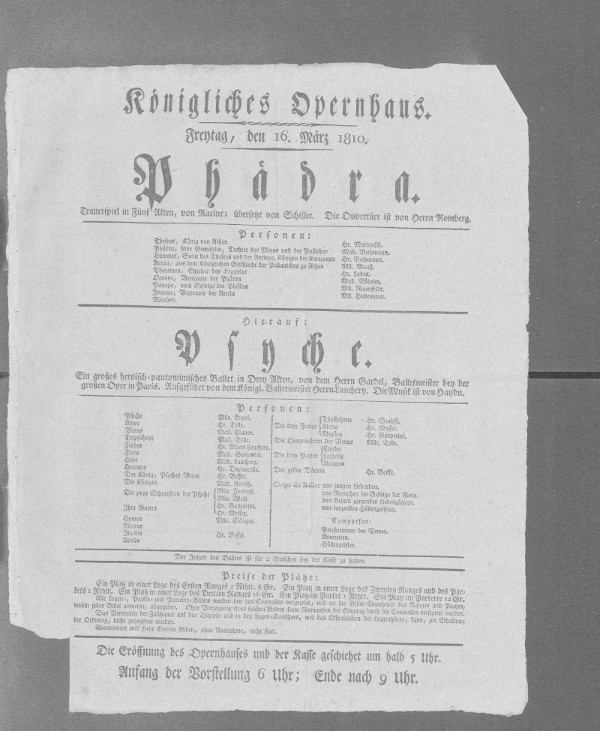
Anzeige. Morgen, Sonnabend den 2. Februar, wird gegeben: Vetter Kukuk, Lustspiel in 1 Akt. Donnerstag den 7. Februar, wird im Königl. Opernhause gegeben: Die Vestalin, lyrisches Drama in 3 Akten. Einlaß-Billets, zu den bekannten Preisen, sind bey dem Kastellan Herrn Dölz im Opernhause zu haben
Mad. Bethmann
Hr. Rebenstein
Mll. Maaß
Hr. Labes
Mad. Böheim
Mll. Ritzenfeldt
Mll. Hudemann
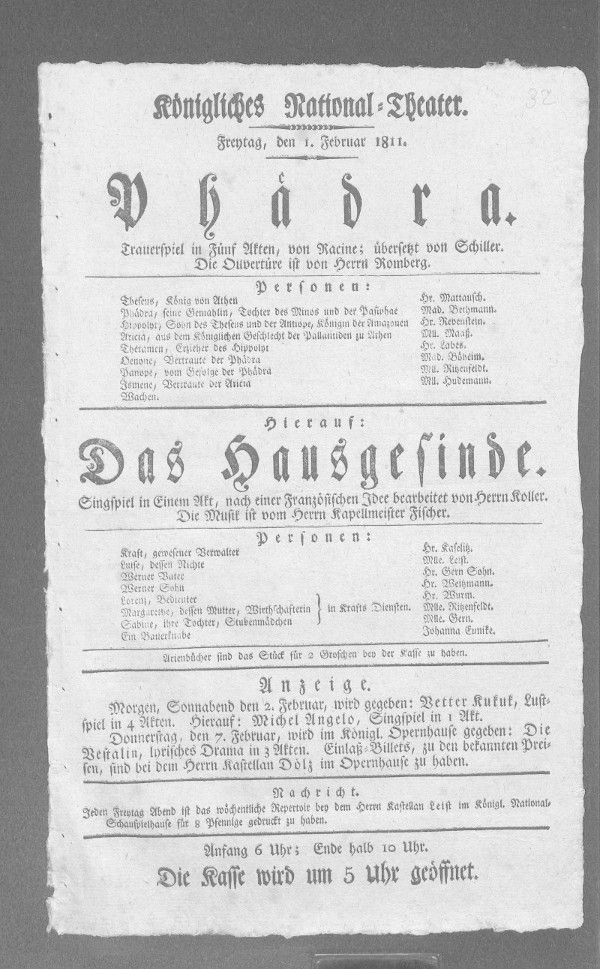
Hr. Rebenstein
Hr. Labes
Mad. Böheim
Mll. Ritzenfeldt
Mll. Hudemann
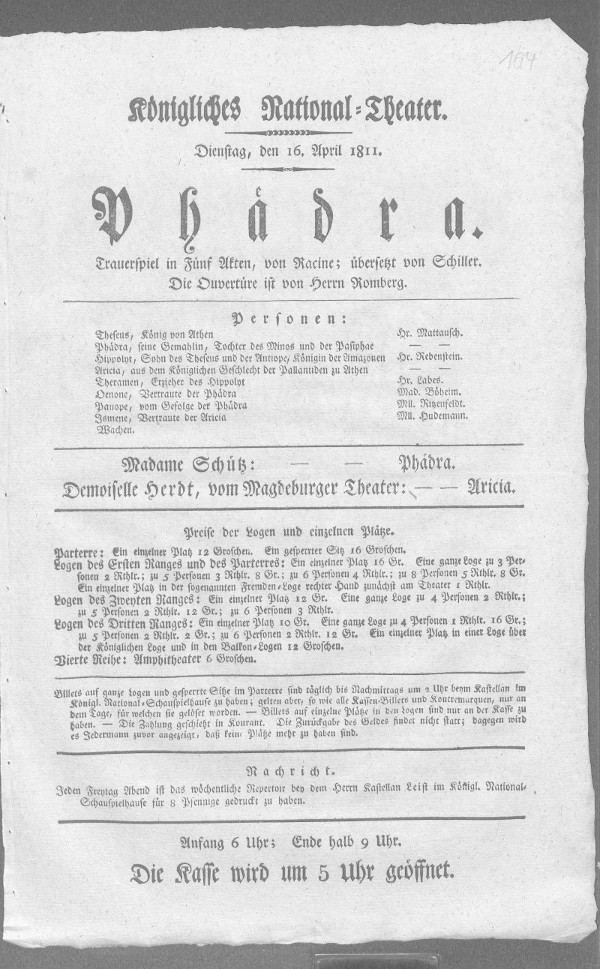
Mad. Bethmann
Hr. Behmann
Mll. Maaß
Hr. Labes
Mad. Böheim
Mll. Ritzenfeldt
Mll. Hudemann
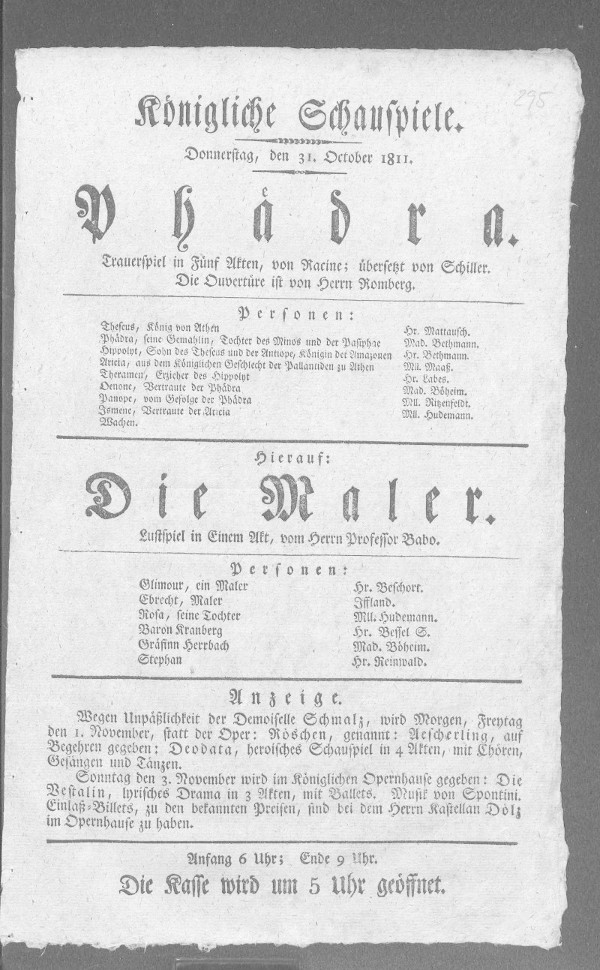
Hr. Bethmann
Mll. Maaß
Hr. Labes
Mad. Böheim
Mad. Friedel
Mll. Hudemann
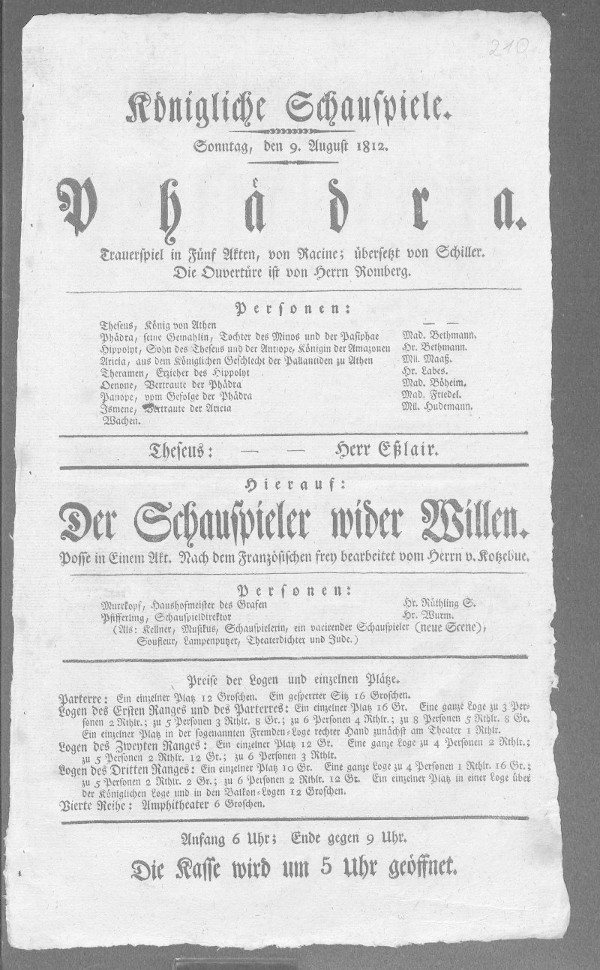
Anzeige. Sonntag, den 15. August, auf Begehren: Deodata, heroisches Schauspiel in 4 Akten, mit Chören, Gesängen und Tänzen
Mad. Bethmann
Hr. Bethmann
Mll. Maaß
Hr. Gern S.
Mad. Böheim
Mll. Ritzenfeldt
Mad. Esperstedt
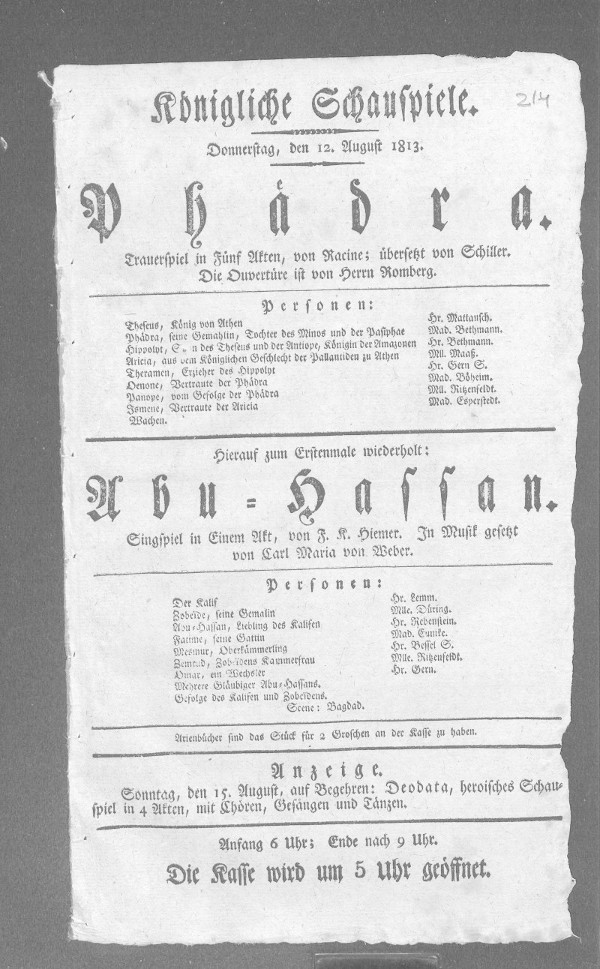
Anzeige. Morgen, Donnerstag den 3. Februar: Don Juan, kom. Singspiel in 4 Akten. Musik von Mozart. Wegen Heiserkeit des Herrn Lemm, kann das Trauerspiel: Ein Tag des Schicksals, Morgen nicht gegeben werden
Bekanntmachung. Bei dem Kastellan Hernn Leist ist aus dem Singspiel: Feodore, zu haben: Klavierauszug, 2 Rthlr. 8 Gr.; so wie auch einzeln: Ouvertüre, Arien und Duetten
Mad. Bethmann
Hr. Bethmann
Mll. Maaß
Hr. Labes
Mad. Böheim
Mll. Ritzenfeldt
Mad. Esperstedt
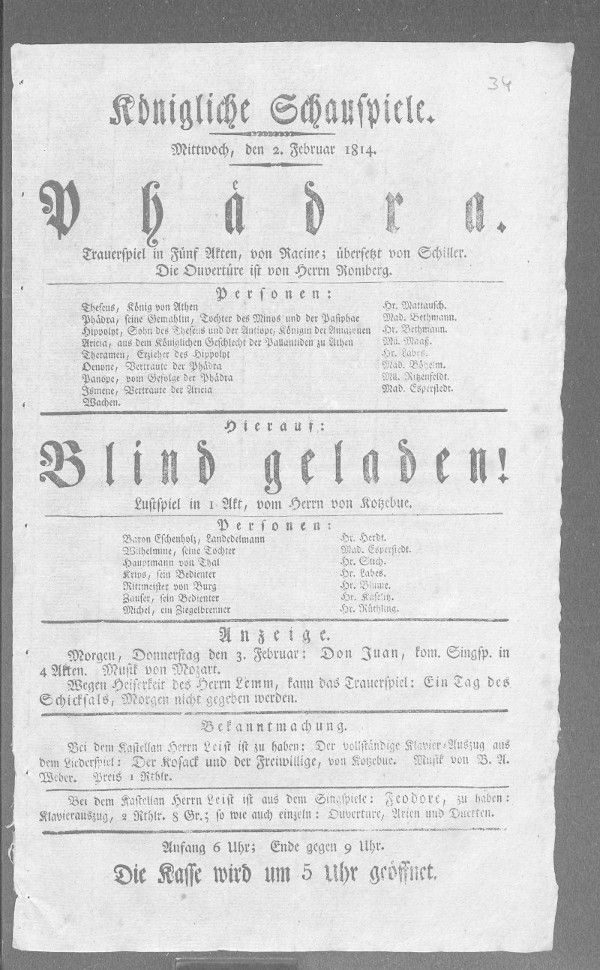
Nationaltheater: Phädra (bearbeitet von Klaus Gerlach), Berliner Klassik, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 2003-2013. URL: https://berlinerklassik.bbaw.de/nationaltheater/theaterstueck/190.
Link zu den API-Daten: https://berlinerklassik.bbaw.de/api/nationaltheater/theaterstueck/190